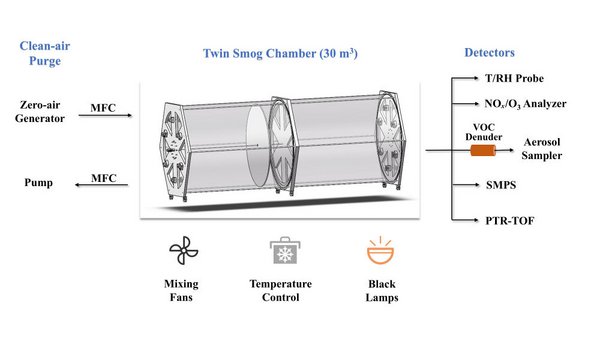Mehr Wasserdampf führt zu mehr aromatische Nitroverbindungen in Partikeln
Shanghai/Leipzig,
13.10.2025
– HH / TA
Internationales Forschungsteam entdeckt neuen Reaktionsmechanismus, der zu mehr nitroaromatischen Verbindungen in Partikeln führt.
Shanghai/Leipzig. Die Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle in der Kontrolle des Gehalts nitroaromatischer Verbindungen (NACs) in Partikeln in der Luft. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Prof. Jianmin Chen von der Fudan University in Shanghai, China. Aus gasförmigem Wasser bilden sich dabei sogenannte Wassercluster (WCs), die dafür sorgen, dass energetische Barrieren im Verlauf der Gasphasenreaktionen vermindert werden und dieser Reaktionspfad auch unter atmosphärischen Bedingungen konkurrenzfähig wird. Der neue Reaktionspfad füllt eine Wissenslücke zu diesen weit verbreiteten Verbindungen mit Auswirkungen auf Luftqualität, Klima und Gesundheit. Die Ergebnisse sind jetzt in Science Advances, dem Open-Access-Journal von SCIENCE erschienen.
Nitroaromatische Verbindungen (engl. ‚Nitroarmatic Compounds‘ oder ‚NACs‘) sind organische Verbindungen, die einen oder mehrere Nitrogruppen an einem Benzolring enthalten. Sie werden technisch zur Herstellung von Farbstoffen, Arzneimittel oder auch Sprengstoff genutzt. Aber auch für die Atmosphärenchemie und damit das globale Klima haben sie Bedeutung, weil die enthaltenen Nitrogruppen die Eigenschaften der Verbindungen kontrollieren. Aromatische Nitroverbindungen können erhebliche Gesundheitseffekte beim Menschen zeitigen oder auch toxisch auf Pflanzen wirken.
An der Studie mitgearbeitet hat u.a. der Leipziger Atmosphärenchemiker Prof. Hartmut Herrmann vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS). Er lehrt neben der Universität Leipzig auch an der Fudan University in Shanghai und der Shandong University in Qingdao in China. „Die neuen Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung eines bisher unterschätzen Reaktionsweges, der sehr wichtig ist, um den Gehalt von nitroaromatischen Verbindungen in atmosphärischen Partikeln richtig beschreiben zu können,“, erklärt Hartmut Herrmann. „Künftige Atmosphärenmodelle sollten daher diese Wassercluster und ihre Wirkung berücksichtigen, um die Vorhersage des Anteils nitroaromatischer Verbindungen in Partikeln zu verbessern, bestehende Feldmessungen besser interpretieren zu können und - nicht zuletzt - die gesundheitliche Wirkung solcher Substanzen in Partikeln besser abschätzen zu können.“
Publikation:
Haiping Xiong, Xiaoyu Liu, Chongwen Sun, Xiangyu Zhang, Xinming Wang, Jingxin Lin, Likun Xue, Xiaomin Sun, Xiaona Shang, Fangfang Ma, Hongbin Xie, Jingwen Chen, Gang Yan, Jiangbin Shu, Hongbo Fu, Lin Wang, Yinon Rudich, Christian George, Abdelwahid Mellouki, Defeng Zhao, Xinke Wang, Hartmut Herrmann, and Jianmin Chen. Atmospheric water cluster–catalyzed formation of nitroaromatics as a secondary aerosol source. Sci. Adv. 11, eadv7805 (2025).) 8 October 2025 DOI: 10.1126/sciadv.adv7805
https://doi.org/10.1126/sciadv.adv7805
Die Forschungsarbeiten wurden gefördert vom Ministry of Science and Technology of China (no.
2022YF3701101), der National Natural Science Foundation of China (nos. 22336001 and 22476133), der Science & Technology Commission of Shanghai Municipality (nos. 21DZ120230 and 21230780200) sowie einem Agilent Applications and Core Technology-University Research (ACT -UR) Gift Grant (no. 4606).
Kontakte:
Prof. Dr. Hartmut Herrmann
Leiter, Abteilung Chemie der Atmosphäre, Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) & Universität Leipzig
Tel. +49-341-2717-7024
https://www.tropos.de/institut/ueber-uns/mitarbeitende/hartmut-herrmann
oder
Tilo Arnhold
Öffentlichkeitsarbeit, TROPOS
Tel. +49-341-2717-7189
http://www.tropos.de/aktuelles/pressemitteilungen/
Links:
Shanghai Key Laboratory of Atmospheric Particle Pollution and Prevention
https://shlap.fudan.edu.cn/shlapen/main.htm
Das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, die 96 selbständige Forschungseinrichtungen verbindet. Ihre Ausrichtung reicht von den Natur-, Ingenieur- und Umweltwissenschaften über die Wirtschafts-, Raum- und Sozialwissenschaften bis zu den Geisteswissenschaften. Leibniz-Institute widmen sich gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch relevanten Fragen.
Sie betreiben erkenntnis- und anwendungsorientierte Forschung, auch in den übergreifenden Leibniz-Forschungsverbünden, sind oder unterhalten wissenschaftliche Infrastrukturen und bieten forschungsbasierte Dienstleistungen an. Die Leibniz-Gemeinschaft setzt Schwerpunkte im Wissenstransfer, vor allem mit den Leibniz-Forschungsmuseen. Sie berät und informiert Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit.
Leibniz-Einrichtungen pflegen enge Kooperationen mit den Hochschulen - u.a. in Form der Leibniz-WissenschaftsCampi, mit der Industrie und anderen Partnern im In- und Ausland. Sie unterliegen einem transparenten und unabhängigen Begutachtungsverfahren. Aufgrund ihrer gesamtstaatlichen Bedeutung fördern Bund und Länder die Institute der Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam. Die Leibniz-Institute beschäftigen rund 21.300 Personen, darunter 12.200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Das Finanzvolumen liegt bei 2,2 Milliarden Euro. Finanziert werden sie von Bund und Ländern gemeinsam. Die Grundfinanzierung des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) getragen. Das Institut wird mitfinanziert aus Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
http://www.leibniz-gemeinschaft.de
https://www.bmbf.de/
https://www.smwk.sachsen.de/